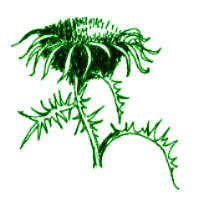| Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Auktion am 7.6. 2025 (Pfingstsamstag), 15 h, in der Darsser Arche, Wieck, Bliesenrader Weg
 |
Los-Nr.: 101 Erholung, Aquarell Augusta von Zitzewitz 1880 - 1960 Signatur: monogr. Erhaltung: altersgemäß Rahmung: gerahmt Maße in cm: 25 x 33 Rufpreis: 180 Schätzpreis: 300 - 400 |
|
| Augusta von Zitzewitz | ||
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
|
||
 |
Los-Nr.: 102 Stilleben, Aqua. Augusta von Zitzewitz 1880 - 1960 Signatur: sign. Erhaltung: altersgemäß Rahmung: gerahmt Maße in cm: 47 x 30 Rufpreis: 600 Schätzpreis: 700 - 900 |
|
| Augusta von Zitzewitz war Künstlerin.Die Berliner Porträtmalerin lebte und arbeitete von 1932 bis 1960 in der Reichsstraße 97 in Berlin-Westend. Offenbar mit Unterstützung, vermutlich nicht gegen den Willen der Mutter, begann Augusta 1907 – da Frauen zu dieser Zeit die Ausbildung an Kunstakademien noch verwehrt war – eine Ausbildung beim Verein Berliner Künstlerinnen und wurde – nachdem sie auf Empfehlung von Käthe Kollwitz in Paris moderne Kunst und Künstler kennengelernt hatte – 1914 Mitglied der Berliner Freien Sezession. Von 1917 bis 1932 erstellte sie Holzschnitte unter anderem für die linksliberale Zeitschrift Aktion. Sie malte Porträts unter anderem von Claire Waldoff, Renée Sintenis, Hedwig Heyl und Louise Schroeder. Nach dem Ende des NS-Staats arbeitete sie in West-Berlin wieder als freischaffende Malerin. 1945/1946 war sie in Ost-Berlin auf der vom Kulturbund zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands veranstalteten Ausstellung Bildender Künstler mit dem Ölgemälde Osterglocken vertreten. 1950 und 1958 hatte sie ehrende Ausstellungen in Charlottenburg.aus Wikipedia | ||
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
|
||
 |
Los-Nr.: 103 Mieten bei Pruchten, Öl Müller-Schönefeld, Claus 1910 - 1991 Signatur: sign. Erhaltung: altersgemäß Rahmung: gerahmt Maße in cm: 47 x 82 Rufpreis: 650 Schätzpreis: 800 - 900 |
|
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
Claus. Müller-Schönefeld, nach einer Malerlehre besuchte er die Kunstgewerbeschule in Berlin, danach von 1935 bis 1939 die Kunsthochschule in Berlin. 194 übersiedelte er nach Pruchte, arbeitete als Kunsterzieher in Barth, beteilgte sich an Asstellungen in Rostock, Stralsund und Ahrenshoop. 1958 zog er nach Althagen. 1996 gab es eine Personalausstellung in Ahrenshoop |
||
|
|
||
 |
Los-Nr.: 104 1901 - 1970 |
|
Hedwig Holtz-Sommer, Malerin und Zeichnerin, 1901 Berlin - 1970 Wustrow.zunächst Schneiderin und Modezeichnerin, danach Studium der Malerei in Weimar. Nach der Hochzeit mit dem Maler Erich Theodor Holtz (Kompagnon von Theodor Schultze-Jasmer in Prerow) zog sie nach Wustrow. Ihre Motive fand sie vor Ort. 1940 erhielt sie den Dürerpreis der Stadt Nürnberg. aus Wikipedia |
||
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
|
||
 |
Los-Nr.: 105 1900 - 1986 |
|
| Hans Kinder, 1900 - 1986, Er begann 1916 ein Studium an der Dresdner Kunstgewerbeschule., 1925 Hospitant am Bauhaus in Weimar, Studium bis 1932 Akademie Dresden. -in Ahrenshoop besaß der Künstler ein Haus und schuf dort viele Blätter. Er war ein bedeutender Vertreter des Dresdner Spätkubismus. Lit.: KLA S. 98 aus Wikipedia |
||
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
|
||
 |
Los-Nr.: 106 1925 lebt in Wieck |
|
| Ruth Klatte, 1925 - lebt in Wieck a. Darß, Malerin und Grafikerin, Ruth Klatte studierte ab 1941 in Dresden an der Staatlichen Akademie für Kunstgewerbe, ab 1943 bei Rupprecht von Vegesack (1917–1976). Dann arbeitete sie als freischaffende Künstlerin in Dresden. Ab 1946 war sie an Ausstellungen beteiligt. Nach der Trennung von ihrem Mann zog Ruth Klatte 1961 nach Wieck, wo sie im Jagdhaus 14 lebt. Bilder Ruth Klattes befinden sich u. a. auch in der Eremitage St. Petersburg, in der Kunsthalle Rostock, Kulturhistorischen Museum Rostock, im Kulturhistorischen Museum Stralsund, im Stadtmuseum Pirna, in den Meininger Museen, im Darß-Museum Prerow und in der Kunstsammlung des vormaligen Landkreises Nordvorpommern. aus wikipedia |
||
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
|
||
 |
Los-Nr.: 107 Darsswald, Öl Hugo Richter-Lefensdorf 1854 - 1904 Signatur: sign. Erhaltung: altersgemäß Rahmung: gerahmt Maße in cm: 26 x 35 Rufpreis: 500 Schätzpreis: 600 - 800 |
|
Hugo Richter-Lefensdorf war Landschafts-, Bildnis- und Stilllebenmaler sowie Radierer. Er erhielt seine Ausbildung in Berlin an der Akademie der Künste bei Eugen Bracht und Christian Wilberg. 1894 kam Richter-Lefensdorf nach Ahrenshoop, wo er 1896 sein Haus in der Dorfstraße 30 bauen ließ. Er gehörte neben Paul Müller-Kaempff, Elisabeth von Eicken, Friedrich Wachenhusen und Fritz Grebe somit zur Gründergeneration der Künstlerkolonie Ahrenshoop. Bis 1903 nahm er regelmäßig an den Berliner Ausstellungen teil, eine Ablehnung seiner Werke im Jahre 1904 konnte er jedoch nicht verkraften und wählte den Freitod. |
||
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
|
||
 |
Los-Nr.: 108 am Schweriner See, Öl. Zscheked, Richard 1896 - 1945 Signatur: sign Erhaltung: in gutem Zustand Rahmung: gerahmt Maße in cm: Rufpreis: 300 Schätzpreis: 400 - 600 |
|
| Richard Zscheked (auch: Richard Zschecked; geboren 6. Dezember 1885 in Weinböhla; gestorben 26. April 1954 in Schwerin) war Maler, Illustrator, Gebrauchsgrafiker und Radierer[1] sowie Kunstgewerbler.[ Nach seinem Schulabschluss an der Bürgerschule in Meißen studierte er anfangs in Zittau an der Sächsischen Höheren Fachschule für Textilindustrie mit dem Abschluss als Webmeister. Er unterhielt danach vier Jahre als Musterzeichner ein kunstgewerbliches Atelier in Gera.[2] Es folgte 1907 ein Studium in Dresden an der Akademie für Kunstgewerbe und schließlich 1908 in Weimar an der dortigen Akademie, an der ihn unter anderem Fritz Mackensen unterrichtete.[1] Zscheked schuf Landschaftsbilder, Buchillustrationen, Gebrauchsgrafik, Plakate und Radierungen. aus Wikipedia | ||
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
|
||
 |
Los-Nr.: 109 der Schnitt, Collage Elena Liessner-Blomberg 1897 - 1978 Signatur: monogr. Erhaltung: altersgemäß Rahmung: gerahmt Maße in cm: 28 x 16 Rufpreis: 400 Schätzpreis: 500 - 600 |
|
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
Elena Liessner-Blomberg, 1897 Moskau - 1978 Berlin, Malerin, Grafikerin ung Textilkünstlerin. Nach Beendigung des Gymnasiums 1914 erhielt Elena Liessner Zeichenunterricht durch ihren Onkel Ernst Liessner, der zuvor im Pariser Exil gelebt hatte und Meisterschüler von Ilja Jefimowitsch Repin war. Nach einjähriger Arbeit als Zeichnerin im NARKOMPROS arbeitete sie 1919 dort als Sekretärin der Abteilung für Bildende Kunst. 1920 begann sie ein Studium der Malerei an den Staatlichen Freien Künstlerischen Werkstätten (Swomas), die später in WChUTEMAS umbenannt wurden. Dort wurde sie unter anderem durch Antoine Pevsner und Ljubow Sergejewna Popowa unterrichtet. Wie viele Mitstudenten verehrte sie die Gedichte Majakowskis, den sie an den WChUTEMAS mehrfach persönlich getroffen hatte. 1921 folgt sie ihrem Freund Eduard Schiemann und siedelte nach Berlin über. Zuvor hatte sie in Moskau dessen Atelier übernommen und führte dessen Zeichenunterricht für Kinder von Eisenbahnern fort. Im selben Jahr wurde ihr Entwurf für den Bühnenvorhang des Berliner Kabaretts Der blaue Vogel ausgewählt. 1924 heiratete sie den Innenarchitekten Albrecht Blomberg; ebenfalls 1924 wurde die Tochter Katja und 1925 der Sohn Michael geboren. In der Zeit von 1933 bis 1945 zog sich Elena Liessner-Blomberg weitgehend künstlerisch zurück und stellte nicht mehr aus. Sie arbeitete als Assistentin ihres Mannes, der als Innenarchitekt Aufträge im In- und Ausland übernahm. Um den Luftangriffen auf Berlin zu entkommen zog die Familie 1943 nach Feldafing. 1951 siedelte die Familie in die DDR über, wo sie mit Künstlern wie Dinah Nelken, Ernst Busch und Herbert Sandberg eine enge Freundschaft pflegte. Zunächst in Pirna ansässig zog die Familie 1954 nach Kleinmachnow, wo ihr Mann Albrecht Blomberg 1962 starb. In Kleinmachnow sehr zurückgezogen lebend erfolgte 1969 eine Neu-Entdeckung der Arbeiten von Elena Liessner-Blomberg. aus wikipedia
|
||
|
|
||
 |
Los-Nr.: 110 bei der Arbeit, Aqua Jeanne Mammen 1890 - 1976 Signatur: sign. Erhaltung: altersgemäß Rahmung: gerahmt Maße in cm: 27 x 20 Rufpreis: 700 Schätzpreis: 800 - 1000 |
|
| Jeanne Mammen (* 21. November 1890 in Berlin als Gertrud Johanna Luise Mammen[1]; † 22. April 1976 ebenda) war eine Malerin, Zeichnerin und Übersetzerin der Moderne. Ihre Arbeiten entstanden im Kontext der veristischen Kunstrichtung. 1901 siedelte die Familie nach Paris über, wo ihr Vater einen Anteil an einer Glasbläserei übernahm. In Paris besuchte sie zunächst das Lycée Molière. Ab 1906 studierte sie Malerei an der Académie Julian, von 1908 bis 1910 an der Académie royale des Beaux-Arts in Brüssel und 1911 an der Scuola Libera Academica (Villa Medici) in Rom. 1915 kam die Künstlerin, nachdem sie mit ihrer Familie weltkriegsbedingt vor der Internierung aus Paris geflüchtet war in Berlin an. Da das väterliche Vermögen beschlagnahmt wurde, war Mammen mittellos. Die Schwestern hielten sich während des Kriegs mit Gelegenheitsjobs über Wasser, u. a. Illustrationen für Paul Schülers „Das Gift im Weibe. Sieben Novellen“ (1917). 1920 bezog sie gemeinsam mit der Schwester Mimi ein Wohnatelier im Hinterhaus Kurfürstendamm 29. Jeanne Mammen blieb bis zu ihrem Tod, 56 Jahre später, in diesem Atelier wohnen. Hier wohnte sie mitten im Geschehen; nicht weit zu ihren bevorzugten Studienobjekten, den jungen, feierwütigen Mädchen und Frauen und ihren zahlenden Begleitern. „Zeichnerische Prägnanz verband sie mit einer Anteilnahme an den Modellen, die sie von Grosz und anderen Veristen unterschied“[4]. Sie begann, dies in Zeichnungen festzuhalten; Zeitschriften und Magazine waren ihre Abnehmer. Mit spitzer Feder ausgestattet, ließ sie sich auf nächtlichen Streifzügen vom großstädtischen Leben anziehen. Mit ihren künstlerischen Milieuschilderungen avancierte sie zu einer der renommierten Bildberichterstatterinnen der 1920er Jahre. Die erste Einzelausstellung in der Berliner Galerie Gurlitt 1930 erntete Beifall in der Berliner Kunstszene. Kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten reiste Mammen nach Moskau, da sie sich für den Sozialismus begeisterte. Nach ihrer Teilnahme an einer Kollektivausstellung 1932/33 bei Gurlitt wurde ihr Schaffensdrang jäh unterbrochen, als die Nazis die Macht übernahmen. Da die meisten der Magazine, für die Mammen arbeitete, nach der Machtübernahme ihr Erscheinen einstellen mussten, verlor die Künstlerin am Höhepunkt ihres Erfolgs ihre Existenzgrundlage. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erhielt sie ihren Rang in der künstlerischen Wahrnehmung zurück. Im Sommer 1945 hatte sie in Berlin-Steglitz eine erste Teilnahme in der Ausstellung Antifaschistische Maler und Bildhauer stellen aus.[5] vertreten waren Werke von ihr in der Ersten Allgemeinen Kunstausstellung 1946 in Dresden. 1947 erfolgte ihre erste Einzelausstellung in der Galerie Gerd Rosen in Berlin, 1948 waren Exponate von ihr in der Galerie Franz in Berlin zu sehen.[6] Von 1949 bis 1950 entwarf sie Bühnenbilder und Kostüme für das dadaistische Kabarett „Die Badewanne“ und später für die „Quallenpeitsche“. 1960 folgte ihre erste große Einzelausstellung mit 42 aktuellen Arbeiten in der Akademie der Künste in Berlin. Dennoch blieb ihre Präsenz auf einen engen Kreis von Bekannten und Freunden beschränkt. Erst in den 1970er Jahren, als man die Werke aus der Zeit der Weimarer Republik wiederzuentdecken begann, erfuhr auch Mammen eine erneute Würdigung. 1971 waren ihr Ausstellungen bei Brockstedt in Hamburg und bei Valentien in Stuttgart gewidmet. Während ihres Studiums in Brüssel und Rom entstand ihr symbolistisches Frühwerk mit Aquarellen, die sich u. a. auf literarische Vorlagen wie etwa auf Gustave Flauberts Die Versuchung des heiligen Antonius bezogen und erst kurz vor ihrem Tod entdeckt wurden. 1913/14 malte sie Frauenfiguren aus dem Pariser Vergnügungslokal Bal Bullier.[7] Nach ihrem Umzug nach Berlin erfolgte ihre erste Veröffentlichung von symbolistischen Illustrationen 1916 im „Kunstgewerbeblatt“: die Zeichnung „Melancolia“, in der sie sich auf Albrecht Dürers berühmte Druckgrafik „Melancholia I“ und Fernand Khnopffs Gemälde „Die Sphinx, die Kunst oder die Liebkosungen“ gleichermaßen kritisch bezog. Mammen tauschte die Geschlechter, indem sie eine androgyn anmutende junge Frau auf den steinernen Pranken einer ägyptischen Sphingenstatue positionierte.[8] Nach Anfängen als Modezeichnerin in Berlin wurde sie im Laufe der 1920er Jahre mehr und mehr zu einer Schilderin des Berliner Alltags – durch ihre Karikaturen, Aquarelle und Federzeichnungen. Diese erzählen von den Anstrengungen der Durchschnittsfrau und kleinen Angestellten, sich dem Leitbild der Weimarer Zeit anzupassen. Den Durchbruch schaffte sie in dem ab 1924 erscheinenden Herrenmagazin „Der Junggeselle“. Sie festigte in den folgenden Jahren ihren Ruf als Zeichnerin durch Illustrationen für den Simplicissimus, den Ulk, den Junggesellen sowie als Mitarbeiterin für die Kunst- und Literaturzeitschrift Jugend. Ihr unverkennbarer karikaturistischer Stil veranlasste Kurt Tucholsky, ihr sein Lob auszusprechen: „In dem Delikatessenladen, den uns Ihre Brotherren wöchentlich oder monatlich aufsperren, sind Sie so ziemlich die einzige Delikatesse.“[9] Die Illustratorin verlor nach 1933 ihre Existenzgrundlage, zog sich in ihr Atelier und in die innere Emigration zurück. ihre wirtschaftliche Grundlage sicherte sie sich – unter anderem – durch den Verkauf von Büchern und Bildern, die sie auf den Straßen Berlins von einem Karren aus feil bot. „Gemalt hat sie immer weiter, doch was sie malte, blieb verborgen – es war bewusst „entartet“ gemalt, wie sie sagte.“[10] Während des Krieges experimentierte sie brotlos weiter, ihre Arbeiten nach 1945 wurden zunehmend abstrakt. In den 1960er Jahren begann sie Collagetechniken mit ihren Zeichnungen zu verbinden. Am 6. Oktober 1975 vollendete sie ihr letztes Bild, das posthum „Verheißung eines Winters“ genannt wurde.[11] Auch als Übersetzerin war Mammen tätig. So erschien etwa 1967 in der Insel-Bücherei ihre Umdichtung von Arthur Rimbauds Illuminationen.[12]Nach ihrem Tod gründeten Freunde wie Hans Laabs, Hübner und Klünner die Jeanne-Mammen-Gesellschaft e. V.[17] Eine Art Renaissance erfuhren ihre Werke in den 1990er Jahren, in denen Museen und Galerien ihr zahlreiche Ausstellungen widmeten. In feministischen Kreisen wird sie seither verbreitet rezipiert. Am Haus Kurfürstendamm Nummer 29 hängt eine „Berliner Gedenktafel“ mit der Aufschrift: „Hier – im IV. Stock des Hinterhauses – lebte und arbeitete in ihrem Atelier von 1919 bis 1976 die Malerin und Graphikerin Jeanne Mammen (21.11.1890 – 22.4.1976). | ||
| Gebot per mail | Gebot telefonisch | Gebot schriftlich |
|
|
||
| Seite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
chw UG (haftungsbeschränkt). - ganzjährig Kunsthandel + Auktionen - Kielstrasse 13 - 18375 Wieck/Darss
Tel.: 0160 - 9859 4004 bzw. 038233 - 70 99 74 - e-mail : kunstauktion@christopherwalther.com
Einlieferungen von Gemälden europäischer Künstlerorte erwünscht